Kerstin auf Instagram: @kerstin_held
So lange ich denken kann...
… habe ich vier Räder neben mir und fühle mich vollständig damit.
Ich bin 1975 im Ruhrgebiet geboren worden und meine Eltern waren sehr glücklich über das kleine gesunde Mädchen, was zunächst drei Tage lang die Augen nicht öffnete. Als ich die Welt dann doch mal sehen wollte, habe ich grandios geschielt. Im ersten Moment hatte meine Mutter den Reflex: „Gott Kind, mach die Augen wieder zu…“
Erzählungen zufolge, war ich ein zufriedenes Kind, das schnell lernte und dem Leben offen gegenüberstand. Drei Jahre später, im März 1978, erblickte meine kleine Schwester Silke das Licht der Welt. Ich hatte mir überlegt, mich richtig schick zu machen und cremte mich mit dem großen Pott Wundschutzcreme überall ein, der für das Baby auf dem Wickeltisch bereitstand. Hat schon mal jemand versucht, diese Creme aus den Haaren wieder raus zu bekommen?
Die ersten Monate des Geschwisterlebens waren wohl normal anstrengend, bis Silke irgendwie keine „Lust“ hatte, sich so richtig zu bewegen. Meine Mutter war viel mit ihr im Krankenhaus und ich fragte mich immer, was denn nun so schlimm bei ihr sei. Sie und ich kannten uns und unser Miteinander war nicht irgendwie anders. Sie war eben meine Schwester.
>>„Sei froh, dass Du laufen kannst!“ Warum sollte ich froh sein?<<
 Wir wohnten mittlerweile im Münsterland und Silke hatte so ein echt cooles Teil. Man nannte es „E-Rolli“ und ich wollte das auch so gerne unbedingt so ein cooles Teil haben. Außerdem wollte ich auch ein Bananenbrot mit Gummibärchen bekommen, wenn ich krank war und ich wollte bitte auch, dass man so viel über MICH spricht, wie über Silke! Ich konnte es nicht verstehen, dass die Großen immer zu mir sagten: „Sei froh, dass Du laufen kannst!“ Warum sollte ich froh sein? Wofür denn? Für den Verzicht? Für die hohe Erwartungshaltung an mich? Dafür, dass Silke immer alle Aufmerksamkeit bekam?
Wir wohnten mittlerweile im Münsterland und Silke hatte so ein echt cooles Teil. Man nannte es „E-Rolli“ und ich wollte das auch so gerne unbedingt so ein cooles Teil haben. Außerdem wollte ich auch ein Bananenbrot mit Gummibärchen bekommen, wenn ich krank war und ich wollte bitte auch, dass man so viel über MICH spricht, wie über Silke! Ich konnte es nicht verstehen, dass die Großen immer zu mir sagten: „Sei froh, dass Du laufen kannst!“ Warum sollte ich froh sein? Wofür denn? Für den Verzicht? Für die hohe Erwartungshaltung an mich? Dafür, dass Silke immer alle Aufmerksamkeit bekam?
Ich war irgendwie anders als die anderen.
In meiner Familie war ich nicht behindert genug und in der Außenwelt zu besonders. Ich kam mit fünf Jahren in die Schule, konnte zu diesem Zeitpunkt bereits das kleine Einmaleins und spielte Klavier. Ich war gefühlt nie krank und wenn doch, war dafür nicht viel Raum. Ich wusste sehr früh, dass meine Schwester die Spinale Muskelatrophie hatte und meine Kinder das später auch mal bekommen könnten. Außerdem wartete ich jedes Mal darauf, dass Silke stirbt, wenn sie mal wieder im Krankenhaus war. Meine Mutter hatte mich sehr früh genau aufgeklärt und mich in die Pflicht genommen, es Silke aber niemals zu sagen. Es war schlimm. Ich wusste, dass sie sterben würde. Aber sie selbst wusste es nicht. Silke erzählte immer davon, dass sie Krankenschwester werden wollte, aber ich wusste, dass es nie so sein würde. Manchmal wünschte ich mir sogar, dass sie nicht mehr aus dem Krankenhaus kommt, damit ich endlich frei war. Frei von Pflichten, denn ich versorgte Silke mit 12 Jahren komplett alleine und musste zu Hause viel helfen. Meine Mutter war kein einfacher Mensch und ich weiß heute, dass sie mir diese Bürde niemals absichtlich aufgeladen hat. Sie konnte es einfach nicht besser schaffen. Meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Zeit getrennt.
Es kam der Tag der Tage.
 Heilig Abend 1993 um 17:34 Uhr hörte Silkes Herz auf zu schlagen. Ich war gerade 4 Wochen volljährig und vor dem Gesetz erwachsen geworden. Mein Leben war immer so voller Bewegung und Verpflichtung, dass ich mich immer viel älter fühlte, als ich auf dem Papier war. An diesem Tag war ich wieder ganz klein. Meine kleine Schwester starb nicht, wie es jeder erwartete, an ihrer Behinderung. Ein betrunkener Autofahrer fuhr viel zu schnell und nahm sie mit – für immer. An diesem Abend wollte ich nichts mehr. Kein Auto mehr fahren, nicht mehr Ergotherapeutin werden, nichts. Meine Lebenspläne wurden mir mit dem Geräusch des Aufpralls aus meinem Kopf und Herzen geschossen, wie eine Kugel aus dem Lauf eines Gewehrs.
Heilig Abend 1993 um 17:34 Uhr hörte Silkes Herz auf zu schlagen. Ich war gerade 4 Wochen volljährig und vor dem Gesetz erwachsen geworden. Mein Leben war immer so voller Bewegung und Verpflichtung, dass ich mich immer viel älter fühlte, als ich auf dem Papier war. An diesem Tag war ich wieder ganz klein. Meine kleine Schwester starb nicht, wie es jeder erwartete, an ihrer Behinderung. Ein betrunkener Autofahrer fuhr viel zu schnell und nahm sie mit – für immer. An diesem Abend wollte ich nichts mehr. Kein Auto mehr fahren, nicht mehr Ergotherapeutin werden, nichts. Meine Lebenspläne wurden mir mit dem Geräusch des Aufpralls aus meinem Kopf und Herzen geschossen, wie eine Kugel aus dem Lauf eines Gewehrs.
Nun, was soll ich sagen?
Ich sammelte mich schnell wieder, denn es ging wie immer auch in diesem Moment nicht um mich. Niemand hatte eine Idee davon, dass es nun – ohne Silke – eine ganz neue Lebensart für mich war. Ich kannte es doch niemals anders, als vier Räder neben mir zu haben. Da zu sein, wenn sie aus der Schule kam. Nachts aufzustehen, wenn sie durstig war. Ich spielte mit ihr „Fangen und Verstecken“ und tat stets so, als sei es spannend, mit einem Koloss von Rolli und einer Endgeschwindigkeit von 6 km/h. Jeder fragte mich, wie es denn meiner Mutter ginge und man erzählte mir, dass es nichts Schlimmeres gäbe, als sein Kind zu verlieren. „Ist das so?“ – fragte ich mich immer wieder.
Mit Silke habe ich vieles lernen dürfen: Ich weiß, dass keiner einen Menschen geboren haben muss, um ihn aus tiefem Herzen lieben zu können. Es ist allenfalls unsere eigene Erwartungshaltung, die uns enttäuschen kann, aber nicht unser Gegenüber. Wenn du ein guter Mensch bist, dann kannst du niemanden verlieren, aber andere können dich als Menschen an ihrer Seite verlieren. Das alles macht einen gewaltigen Unterschied. Ich bin durch meinen Weg mit meiner Schwester privilegiert, die Welt mit offenen Augen zu sehen.
>>Inklusion ist für mich keine Prozessbeschreibung.<<
Welche Menschen bemühen sich um die sogenannten Inklusionsprozesse? Sind es solche, die wirklich in der Lage sind, in inklusiven Bildern zu denken? Es braucht keine ISO Norm oder teuren Gutachter! Aber es braucht zunächst Toleranz und Empathie – und davon ganz viel. Ein inklusives Lebensverständnis kann nicht studiert werden, man muss erleben und einfach mal machen!
Ich versuche immer wieder Wege zu finden, um Inklusion spürbar zu machen – sei es mit einer kleinen Geste, einer lustigen Idee oder mit einprägsamen Worten. Denn nur wenn wir Menschen inklusiv hinein spüren können und eine Erinnerung schaffen, bleibt dies für immer in unserem Kopf. Aus der Erinnerung wird wieder ein Gefühl und so kann Inklusion zu einem wunderbaren Lebensgefühl werden.
In diesem Sommer kam mir wieder so eine Idee.
 Ich bekam den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen und trug an diesem Tag weiße Turnschuhe. Dieser Orden bedeutet für mich nicht, dass ich am Ziel bin, sondern dass ich am Anfang einer Reise stehe, die nun wachsamer begleitet wird als zuvor. Weiße Sneakers sind irgendwie ein Dauerbrenner und voll im Trend. Es gibt sie in allen Ausführungen und Preisklassen. Sie passen zum lässigen Sportlook bis zum Businessanzug. So motivierte ich an diesem Tag einen lieben Freund, aus seinen glänzenden Anzugschuhen zu steigen und ebenfalls seine weißen Sneakers anzuziehen, die er immer im Auto hat. Gesagt, getan. An diesem besonderen Tag entstand das Foto zur heutigen Kampagne #walkinginmyshoes.
Ich bekam den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen und trug an diesem Tag weiße Turnschuhe. Dieser Orden bedeutet für mich nicht, dass ich am Ziel bin, sondern dass ich am Anfang einer Reise stehe, die nun wachsamer begleitet wird als zuvor. Weiße Sneakers sind irgendwie ein Dauerbrenner und voll im Trend. Es gibt sie in allen Ausführungen und Preisklassen. Sie passen zum lässigen Sportlook bis zum Businessanzug. So motivierte ich an diesem Tag einen lieben Freund, aus seinen glänzenden Anzugschuhen zu steigen und ebenfalls seine weißen Sneakers anzuziehen, die er immer im Auto hat. Gesagt, getan. An diesem besonderen Tag entstand das Foto zur heutigen Kampagne #walkinginmyshoes.
Der weiße Schuh als Symbol für Empathie war schnell zu Ende gedacht. Laufe in meinen Schuhen, um deine Wahrnehmung und deinen Blickwinkel zu verändern. Es kostet Mühe, weiße Schuhe weiß zu halten – ebenso, wie unser Miteinander nicht ohne Bemühungen gelingen kann. Von nun an werden Fotos von Menschen mit weißen Sneakers in verschiedensten Lebenssituationen in den sozialen Medien geteilt. Mit den Hashtags #walkinginmyshoes und #inklusionschaffenwir wird jedes Foto nun ein Teil der Kampagne.
Machen wir Inklusion zu einem Lebensgefühl – gemeinsam!
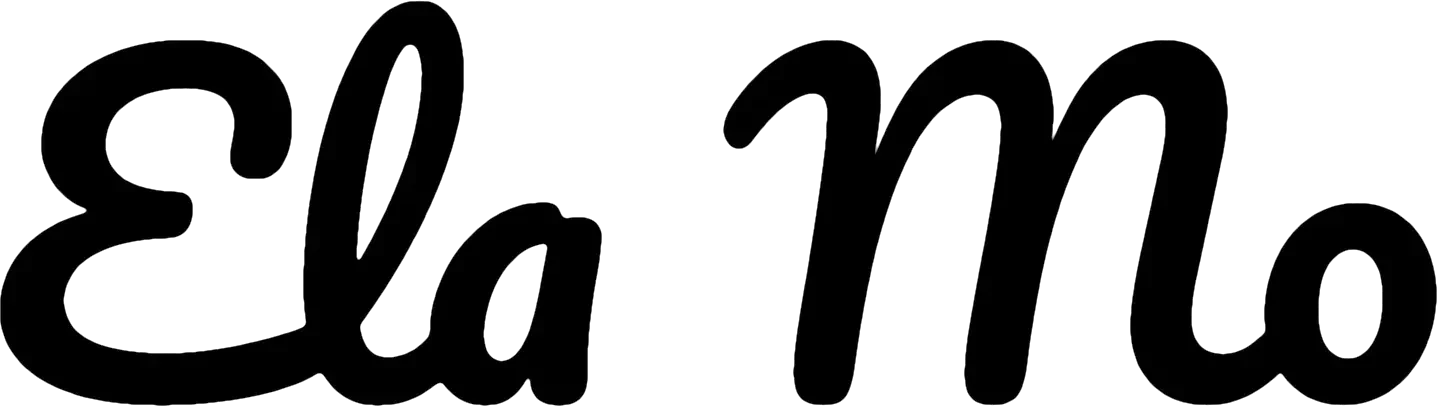
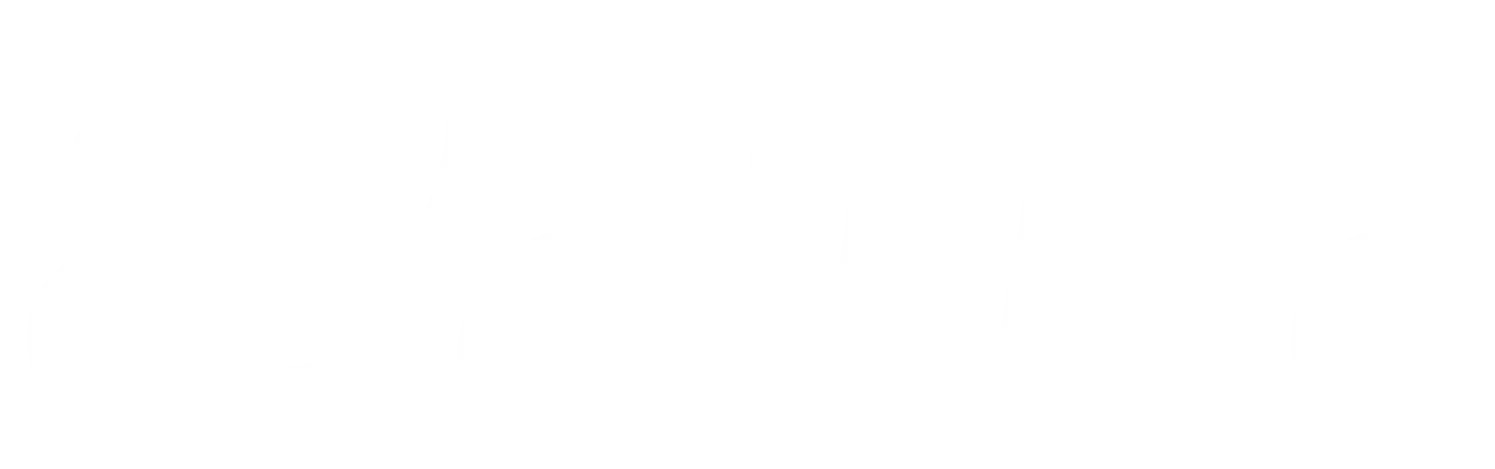








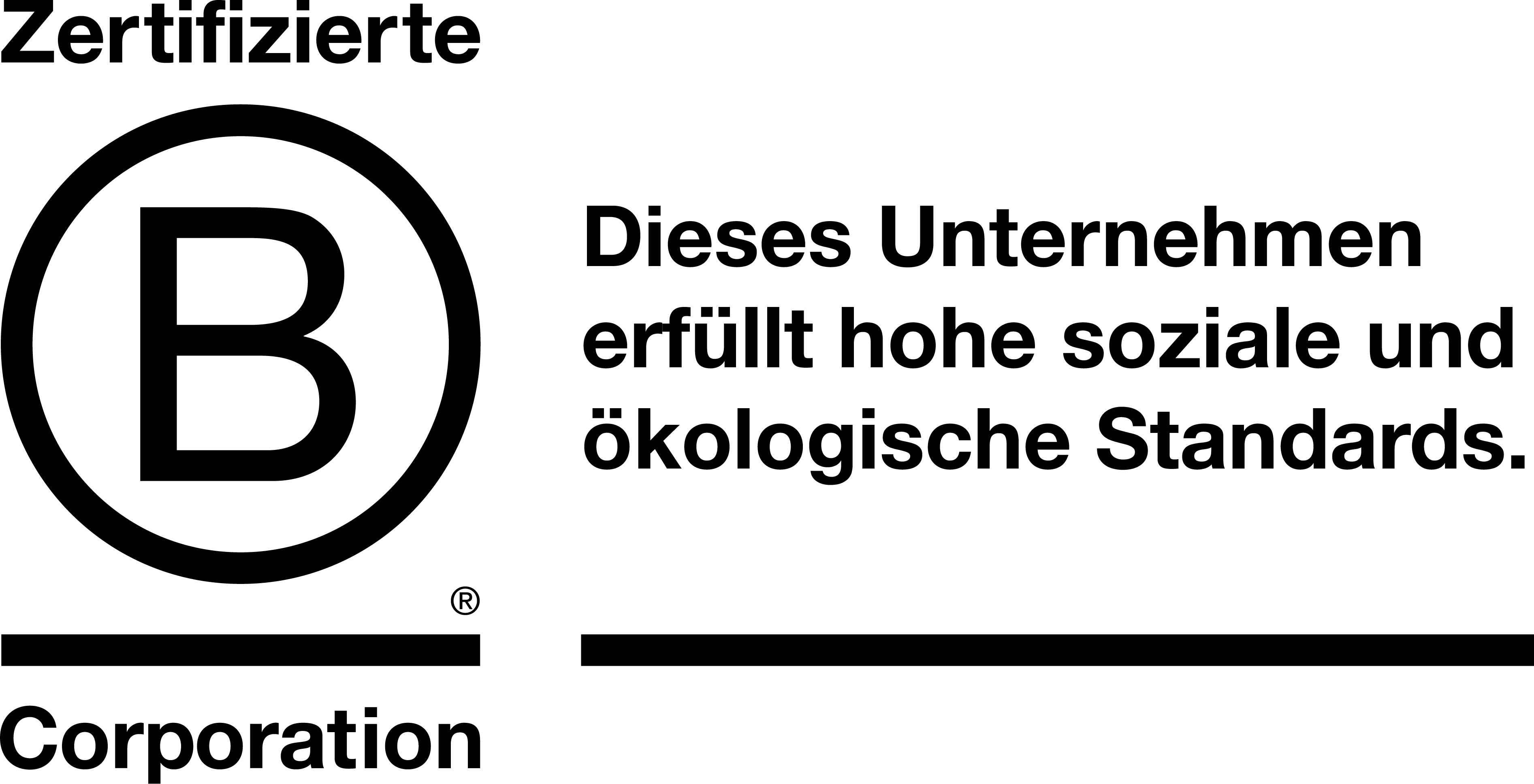
Share:
"Diagnose Leben"
"Angry Cripples": Eine Empowerment-Plattform von behinderten Menschen für behinderte Menschen